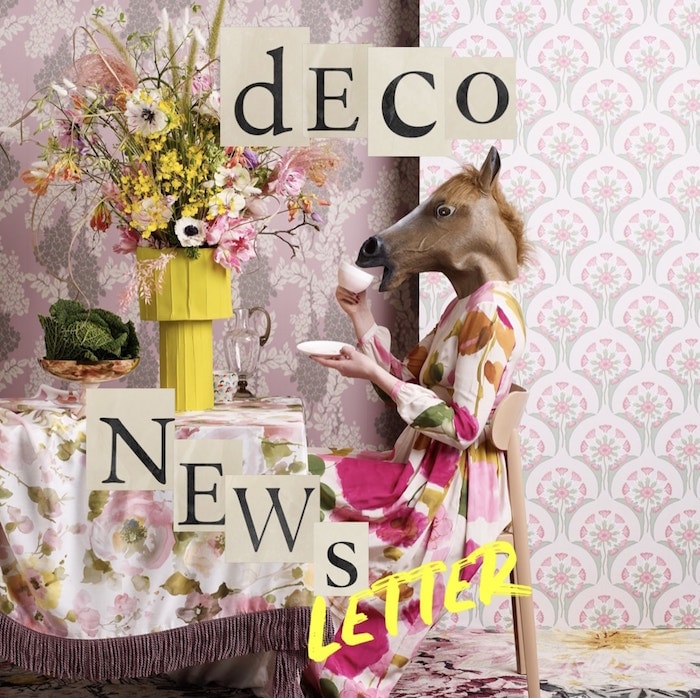Sie ermöglicht raffinierte Ein- und Durchblicke und ist doch mit ihren Motiven und Ornamenten selbst schon ein Blickfang. Wir verraten, woher die Spitze kommt, erklären die bekanntesten Varianten und zeigen Highlights aus den aktuellen Kollektionen.

Luftspitze Nature’s Dialog von Fischbacher 1819 aus reiner Baumwolle mit Spitze aus Stegen und Schlaufen.
Die Spitze und ihr Reize
Kaum ein Textil verkörpert mehr feminine Eleganz als die Spitze. Ihr gelingt mühelos der Brückenschlag vom hochgeschlossenen Spitzenkragen für tugendhafte Hausfrauen zum aufreizenden Dessous für frivole Lebedamen. Wenig verwunderlich, dass sie gerade im Rokoko ihre größte Blütezeit erlebte – ging die Mode am französischen Königshof zeitenweise sogar soweit, den Ausschnitt von Damenkleidern bis unterhalb der Brustwarzen herunterzuziehen und diese lediglich mit etwas Spitze zu bedecken.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Heute wird Spitze überwiegend für Dessous und Nachtwäsche verwendet. Derzeit ist sie jedoch in der Mode wieder so angesagt, dass fast jede Frau wenigstens ein Bluse oder Kleid daraus im Schrank hat. Und nicht nur das: Sogar Keramik wird mittlerweile damit „bedruckt“ (siehe oben). Die Bezeichnung Spitze ist ein Sammelbegriff für fast alle Textilien, die nur aus Garn bestehen – oder aus Garn und Stoff. Der Begriff leitet sich vom Althochdeutschen spizza oder spizzi ab, was so viel wie Garngeflecht bedeutet. Die Gemeinsamkeit: Sie sind durchbrochen und ihre Muster ergeben sich durch Löcher unterschiedlicher Größe.

Stoff Sarmacanda aus der Kollektion Sentieri di Seta von Ardecora in Crochet, eine Art Häkelspitze.
Geschichte der Spitze
Spitze wird meist als Randverzierung an Kleidungsstücken, Bett- oder Tischwäsche und Dekokissen verwendet. Allerdings war ihre Herstellung so teuer, dass nur die Reichsten sie sich leisten konnten. Die erste Nadelspitze entstand im 15. Jahrhundert in Italien. Bis ins 17. Jahrhundert hatten sich Mailand und Venedig als Zentren der Spitzenfertigung etabliert. Im frühen 18. Jahrhundert löste dann die schnellere und billigere Klöppeltechnik die teure Nadelspitze ab. Zunehmend setzt sich Tüll als Untergrund durch, in den Muster eingearbeitet oder appliziert werden. Ab Beginn des 20. Jahrhundert gelang es, Klöppel- und Lochspitze maschinell zu fertigen. Unter Spitze versteht man heute maschinelle Bohrspitze (Lochspitze), maschinengestickte Tüllspitze, Ätzspitze oder Macramé-Spitze.

Die Webbindung von Yoko von Nya Nordiska enthüllt ein halbtransparentes Schachbrettmuster.
Verschiedene Herstellungsarten
Nadelspitze: Für die Nadelspitze zeichnet man das Muster frei auf eine Pergamentunterlage, spannt dann die Fäden entlang der Zeichnung und umstickt das Grundgitter meist mit Knopflochstich.
Klöppelspitze: Entstand als dekorative Randerzierung an Kleidungsstücken. Um die Herstellung zu vereinfachen, wird die Spitze losgelöst vom Kleidungsstück gefertigt. So entstand die Flechtspitze, denn beim Spitzenklöppeln werden mehrere Fäden miteinander und gegeneinander verdreht, verkreuzt, verknüpft und verschlungen.

Création Baumann stickt mit Edra ein luftiges ornamentales Netz aus Leinen-Jutegarn.
Handgearbeitete Spitze
Reticella-Spitze: Kett- und Schussfäden werden aus einem Leinengrund gezogen oder Flächen ausgeschnitten. Die so kreierten Stege und Löcher werden mit Knopflochstich umstickt, die Löcher mit diagonalen Fäden ausgefüllt und umstickt. Sie war die typische Spitze der Renaissance. Auf der Laguneninsel Burano bei Venedig wird seit dem 16. Jahrhundert Reticella-Spitze gefertigt. Als die Kunst der Spitzenstickerinnen schon fast in Vergessenheit geraten war, wurde 1872 unter dem Protektorat der Königin eine Spitzenschule – die Schola di Merletti – gegründet, in der die Technik des sogenannten „punto in aria“, des luftigen Stichs (wie die Perfektion der Nadelspitze hieß) gelehrt wurde.
Brüsseler Spitze: Bezeichnet Spitzenklöppeleien für die Brüssel um 1700 ein Produktionsschwerpunkt wurde. Die „Königin der Spitze“ hatte ihre Blütezeit vom Barock bis zum Klassizismus.
Duchesse-Spitze: Ebenfalls belgischer Herkunft kam die Duchesse-Spitze Mitte des 18. Jahrhundert auf. Sie verband Klöppel- und Nadelspitztechniken in höchster Perfektion und galt als „Fürstin der Spitzen“.

Die britische Einrichterin Sera Hersham-Loftus ist ein großer Fan von Spitze. Als Tapete setzte sie ihr Lieblingsmotiv hier sogar Flächendecken in einem Gästebad ein
Plauener Spitze: Ist ein Qualitätssiegel für regional gefertigte Stickereierzeugnisse. Ursprünglich war es die in der Gegend um Plauen angesiedelte Veredelung glatter Baumwolle mittels Plattstich-Stickerei. Später verwendete man auch Tüll. Das Ziel den Stickgrund völlig zu entfernen, führte zur Erfindung der Ätzspitze (oder auch Luftspitze). Das Verfahren zu ihrer Herstellung hat ihren Ursprung zeitgleich in Plauen und St. Gallen.
Sankt Galler Spitze: Die Sankt Galler Spitze ist eigentlich eine Ätzspitze, also eine Stickerei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam fast die Hälfte aller Spitze aus der Schweiz. Im Textilmuseum St. Gallen lässt sich bis heute ihre Vielfalt bewundern.

OODD Studios interpretiert die Spitze neu. Noch mehr Infos zur Design-Kooperative in den DECO News. (Bild: Iona Dutz)
Alle Artikel aus unserer Serie Stoffkunde finden Sie →hier.